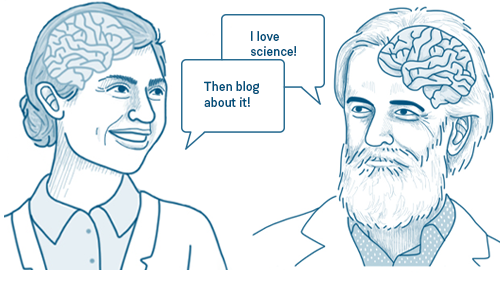Wissenschaftlicher Beirat
Scientific Advisory Council: Clarke folgt auf Keller
In seiner Funktion als Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats (Scientific Advisory Council) hat Dr. Martin Keller in der vergangenen Woche zum letzten Mal eine Sitzung des Beirats geleitet. Am 1. November 2025 wird der international renommierte Wissenschaftler aus den USA der neue Präsident der Helmholtz-Gemeinschaft. Prof. Stephanie Clarke vom Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (Schweiz) übernimmt ab dem 1. Oktober den Vorsitz des Scientific Advisory Council.